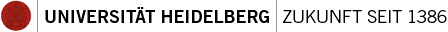Dr. Hürrem Tezcan-Güntekin
Fakultät für Gesundheitswissenschaften, Universität Bielefeld

Interview vom 23.05.2016 zum Vortrag „Situation und Bedürfnisse türkischstämmiger pflegender Angehöriger von demenzerkrankten Menschen “ (durchgeführt von Carmen Grimm)
Frau Dr. Tezcan-Güntekin, Sie sind Expertin für Gesundheit und Versorgung und vereinen sowohl eine soziologische als auch eine medizinische Perspektive auf das Thema. Seit wann beschäftigen Sie sich mit dem Thema Demenz und Migration?
Mittlerweile seit fast vier Jahren. Und mir ist aufgefallen, dass sich innerhalb dieser Zeit das Bewusstsein in der Gesellschaft und in der Politik in Bezug auf dieses Thema sehr gewandelt hat. Die Zahl der an Demenz erkrankten Menschen mit Migrationshintergrund steigt stark an und langsam wird der Handlungsbedarf und die Notwendigkeit bedürfnisorientierter Angebote sowohl für Betroffene als auch für Angehörige noch deutlicher. Dementsprechend passiert momentan sehr viel, es gibt viele politische und Öffentlichkeitsveranstaltungen, zu denen wir, Experten, hinzugezogen werden, und wo mit uns diskutiert wird, an welcher Stelle man Stellschrauben ändern müsste, damit die Inanspruchnahme und Versorgung besser werden und auch künftige Bedarfe gezielt beantwortet werden können.
Wie gestaltet sich die Versorgung älterer türkischstämmiger demenzerkrankter Personen in Deutschland?
Die Erkrankten werden in der Regel zu Hause durch die Angehörigen gepflegt, sehr selten wird dabei ambulante Pflege in Anspruch genommen. Pflege wird bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund als Familiensache verstanden und erfolgt daher ausschließlich innerhalb der Familie. Pflegebedürftige ohne familiäre Anbindung werden stationär gepflegt, das sind allerdings im Moment nur knapp zwei Prozent der Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund. Es gibt einige sehr gute Versorgungsstrukturen, die den Bedürfnissen entsprechen und vergleichsweise auch gut angenommen werden, z. B. Demenz-WGs mit muttersprachlicher Betreuung oder aber muttersprachliche Tagespflegeeinrichtungen für Demenzerkrankte. Aber wie Sie schon sehen, sind es wirklich punktuelle Versorgungsmöglichkeiten oder -angebote, die zwar gut angenommen werden, aber von flächendeckender Versorgung ist überhaupt nicht die Rede.
Für Ihre Dissertation befragten Sie türkischstämmige pflegende Angehörige von demenzerkrankten Menschen. Welche Aspekte zeichneten sich als besonders charakteristisch für die Pflege und Versorgung durch Angehörige ab?
Ganz zentral ist, dass die Pflege häufig nur von einer Hauptpflegeperson übernommen wird, die auch oft belastet ist. Die Krankheit Demenz wird in der türkischen Community häufig nicht als Krankheit wahrgenommen, sondern als Alterserscheinung verstanden. Die Demenz ist immer noch tabuisiert und ähnlich wie in der autochthonen Bevölkerung ist die Tabuisierung der Krankheit recht groß, d.h. viele der Erkrankten gehen mit den Familien nicht ´raus und sind gesellschaftlich nicht mehr so sichtbar. Der Wunsch, die Pflege weiterhin in der Häuslichkeit auszuführen, ist bei den Familien groß – also bei den Pflegebedürftigen selber, aber auch bei den Familien – nur müssten Pflegeaufgaben innerhalb der Familien auf mehrere Schultern verteilt werden, was in manchen Familien schon toll klappt, in anderen aber noch nicht so gut. Die Bedürfnisse können häufig nicht klar formuliert werden, weil wenig Wissen über mögliche Unterstützung vorhanden ist. Ebenfalls wird häufig nicht reflektiert, in welcher Situation sich pflegende Angehörige befinden. Man macht sich auch wenig darüber Gedanken, wie es weitergehen könnte, wenn die Erfordernisse nochmal stärker werden. Es ist viel Ratlosigkeit zu verzeichnen.
Welche Herausforderungen erfahren die pflegenden Angehörigen von demenzerkrankten Menschen?
Für die Betroffenen selber ist eine große Herausforderung die Irritation der Demenzerkrankung – das betrifft aber natürlich nicht nur Menschen mit Migrationshintergrund. Aber was bei Menschen mit Migrationshintergrund noch stark hinzukommt, ist der Verlust der Zweitsprache Deutsch, die sehr früh im Laufe der Krankheit vergessen oder verlernt wird. Dadurch gehen Kontakte verloren, die vorher bestanden haben. Das macht auch etwas mit der Identität der Erkrankten, denn Personen, die vor 30-40 Jahren hierhergekommen sind und kein Deutsch gelernt haben, werden von denen, die es gelernt und sich von dem eigenen Empfinden her gut integriert haben, als nicht besonders erfolgreich angesehen. Und wenn diejenigen, die sich darüber stark definieren, diese Sprache verlieren, aber immer noch merken, dass sie sie früher konnten und jetzt nicht mehr können, – was passiert da mit den Menschen?
Ein anderer Aspekt ist, dass Migrationserfahrung im Zuge der Demenzerkrankung emotional sehr intensiv wiedererlebt und auch erinnert wird. Wenn Pflegende das nicht wissen, können sie schwer damit umgehen, weil sich starke Emotionen dann tatsächlich im Alltag widerspiegeln wie z. B. das Gefühl, seine Heimat zu verlassen oder Freude darauf, was einen erwartet, aber auch die Enttäuschung oder die große Angst, den Akt der Migration zu vollziehen. Es gibt natürlich noch weitere Herausforderungen. Das ist, wie ich schon erwähnt habe, die Isolierung aus Scham innerhalb der eigenen Community. Wenn ambulante oder stationäre Hilfe in Anspruch genommen wird, laufen Familien oft Gefahr, von anderen Familienangehörigen oder Mitgliedern der eigenen Community ausgegrenzt zu werden, weil auch da die Meinung vorherrscht, Pflege müsse innerhalb der Familie geregelt werden. Viele Angehörige wissen außerdem nicht, welche Unterstützungsleistungen es gibt und was ihnen zusteht. Die Belastung ist grundsätzlich groß. Hilfe wird erst in Anspruch genommen, wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn z. B. die Pflegeperson selber erkrankt oder ins Krankenhaus eingeliefert wird. Erst wenn dieses Pflegesetting zusammenbricht, wird überlegt, was es für Möglichkeiten geben könnte, die Person zu entlasten. Oft ist es aber zu spät, weil die an Demenz erkrankte Person ohne Pflege bleibt und häufig miteingeliefert wird, was für sie fatale Folgen haben kann.
Wie können türkischstämmige pflegende Angehörige unterstützt werden?
Zuallererst muss man fragen, welche Unterstützung sich Angehörige wünschen, d. h. das, was anderen Menschen gut passt, z. B. Selbsthilfe, muss nicht das passende Instrument für diese Bevölkerungsgruppe sein. Menschen mit Migrationshintergrund sind eine sehr heterogene Gruppe, oft auch innerhalb eines Herkunftslandes, sodass wir eigentlich gar nicht genau sagen können: „Genau das ist das Richtige für türkischstämmige pflegende Angehörige!“ Man kann nur versuchen, Tendenzen oder Möglichkeiten herauszufinden. Bedürfnisse sind genauso heterogen. Hier gilt es, diese herauszufinden und die bereits bestehenden Versorgungsstrukturen so abzuändern, dass sie hinsichtlich vieler Diversitätsmerkmale funktionieren. Bestehende Strukturen sollen sensibilisiert werden, damit sich Menschen mit unterschiedlichen kulturellen und anderen Bedürfnissen in diesen Angeboten wiederfinden können und diese auch wirklich in Anspruch nehmen.
Erwarten Sie, dass sich die Versorgungssituation türkischstämmiger älterer Personen im Laufe der kommenden Generationen ändern wird?
Grundsätzlich plädieren wir immer dafür, nicht kulturspezifische Angebote, sondern kultur- und diversitätssensible Angebote zu schaffen. Aber gerade im Falle von Demenz und dem Verlust der Zweitsprache Deutsch ist es besonders wichtig, dass auch sprachspezifische Angebote bestehen bzw. entwickelt werden oder aber das Pflegepersonal, das mit türkischen, russischen oder griechischen Menschen mit Demenz arbeitet, sich einen geringen Wortschatz oder ein paar Sätze in der Sprache aneignet, damit zumindest eine grundsätzliche Kommunikation ermöglicht wird. Ich denke schon, dass sich der Zugang zu Angeboten der pflegerischen Versorgung in den kommenden Jahrzehnten ändern wird, und die momentan in der zweiten Generation lebenden Menschen im Alter eventuell auch durch sich verändernde Altersbilder leichter Zugang zu Unterstützung finden werden.
Kulturelle Bilder vom Alter verändern sich aber sehr langsam. Bereits jetzt durchgeführte Untersuchungen von Frau Liane Schenk aus dem Jahre 2014 zeigen aber auch, dass viel mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Erwägung ziehen, ambulante Angebote anzunehmen, viel mehr als bislang eigentlich durch Studien aufgezeigt worden ist. Das heißt, die Tendenz geht schon eher dahin, dass die jetzt in der zweiten und dritten Generation lebenden Menschen mit Migrationshintergrund sich im Alltag noch andere Versorgungsmöglichkeiten vorstellen können als die jetzige erste Generation.