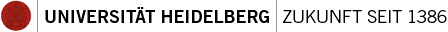Prof. Dr. Johannes Schröder
Leiter der Sektion Gerontopsychiatrie des Universitätsklinikums Heidelberg

Interview vom 9. Mai 2007 mit Dr. Birgit Teichmann
Herr Professor Schröder, Sie sind Leiter der Sektion Gerontopsychiatrie des Universitätsklinikums Heidelberg. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Früherkennung von Demenzen. Welche Warnsignale bei einer beginnenden Demenz gibt es?
Grundsätzlich gibt es eine ganze Reihe von Warnsignalen, die darauf hindeuten können, aber nicht unbedingt eine Demenz ankündigen müssen. Dies ist von entscheidender Bedeutung, da es ja im Alter wie in allen Lebensphasen immer zu Schwankungen des Befindens und der Leistungsfähigkeit kommt.
Diese Einschränkung voran gestellt, möchte ich Störungen der Merkfähigkeit und des Gedächtnisses als wichtigste Warnzeichen nennen. Allerdings müssen Letztere über einen fassbaren Zeitraum bestehen und sich im Verlauf intensivieren. Daneben gibt es andere Vorpostensymptome, vor allem nämlich Störungen der geistigen Flexibilität oder Umstellungsfähigkeit, aber auch Störungen des räumlichen Vorstellungsvermögens, oder sprachlicher und rechnerischer Fähigkeiten. Diese können ebenfalls, müssen aber nicht, in den Frühphasen der Erkrankung auftreten. Neben diesen neuropsychologischen Defiziten kommt es sehr oft zu depressiven und anderen psychischen Symptomen, die das Gesamtbild nachhaltig prägen können.
Wie werden Demenzen bisher diagnostiziert?
Da muss man unterscheiden zwischen der Situation hier bei uns im Raum Heidelberg und der Situation, die wir in anderen Landesteilen haben. Seit Anfang der 90er Jahre, genauer gesagt seit 1994, haben wir mit der Gedächtnisambulanz eine Spezialsprechstunde, in der sich Menschen mit der Frage vorstellen können, ob bei Ihnen passagère Schwankungen bestehen oder ob tatsächlich Symptome vorliegen, die eine weitere Abklärung erfordern.
Diese beruht vor allen Dingen auf einer ausführlichen ärztlichen Untersuchung und einer entsprechenden neuropsychologischen Testung. In den meisten Fällen ist eine Bildgebung, d.h. eine Magnetresonanztomografie des Gehirnschädels, erforderlich. Damit lassen sich Veränderungen, wie sie typischerweise bei demenziellen Erkrankungen auftreten, ohne größere Belastungen darstellen. Sofern die Befunde aus der ärztlichen Untersuchung, neuropsychologischen Testung und Bildgebung die Verdachtsdiagnose einer Demenz ergeben, kann eine Bestimmung molekularbiologischer Krankheitsmarker Klärung schaffen. Letztere werden im Nervenwasser bestimmt und machen deshalb eine Lumbalpunktion erforderlich. Auch diese Untersuchung ist nicht mit weitergehenden Belastungen verbunden.
Die Demenzabklärung erfordert deshalb eine enge Zusammenarbeit verschiedener Fachrichtungen von der Gerontopsychiatrie über die Neuropsychologie bis hin zur Radiologie. In der Gedächtnisambulanz bieten wir aber auch eine Beratung durch unseren Sozialarbeiter, wie eine Gruppe für kognitive und andere Trainingsmaßnahmen, an.
Warum sind neue Diagnosemethoden notwendig?
Es ist ja unser Ziel, diese Erkrankung möglichst früh zu diagnostizieren und dies eben mit größtmöglicher Präzision. Die Patienten kommen schließlich zu uns mit der Frage: "Ist da was, könnte da etwas sein, könnte mich da etwas bedrohen, oder handelt es sich um eine vorübergehende Leistungsstörung ". Schon um diese Frage bestmöglich beantworten zu können, brauchen wir auch weiterhin neue diagnostische Verfahren. Neue diagnostische Verfahren sind aber auch entscheidend, um den Erfolg der Therapie beurteilen zu können. Je weiter sich unsere therapeutischen Möglichkeiten entwickeln, desto mehr sollte sich auch die Diagnostik verfeinern, um die entsprechenden Effekte abbilden zu können. Damit könnte eine Anpassung oder Optimierung der Therapie möglich werden.
Die häufigste Form der Demenz, die Alzheimer-Demenz, gilt als nicht heilbar. Welchen Sinn hat hier die Früherkennung?
Früherkennung hat zwei Gründe. Zum einen sind die Patienten bereits von ersten Symptomen betroffen, die sie bemerken auch wenn sie noch nicht ausgeprägt sind. Das ist ein ganz verständliches Anliegen, das wir hier in Heidelberg auch sehr ernst nehmen. Ferner können die heute zur Verfügung stehenden Mittel den Verlauf einer Alzheimer Erkrankung abmildern, bzw. ihre Konsequenzen etwas abfedern. Ich meine hier nicht nur eine pharmakologische Einstellung auf bestimmte Medikamente, die entweder die Symptomatik günstig beeinflussen oder eben den Verlauf abbremsen. Von großer Bedeutung sind darüber hinaus Trainingsverfahren, aber auch die Gestaltung des Wohnumfeldes, oder eben die Frage der Lebensplanung überhaupt.
Ist es sinvoll, an einer Früherkennungsuntersuchung teilzunehmen, wenn ein naher Verwandter an AD erkrankt ist, man selbst jedoch keine Symptome aufweist?
Das würde ich grundsätzlich nicht bejahen. Sofern zahlreiche Angehörige betroffen sind, noch dazu in jüngeren Jahren, also vor dem 60. Lebensjahr kann es sicherlich sinnvoll sein, die Gedächtnissprechstunde aufzusuchen. Wenn es sich dagegen um sporadische Erkrankungsfälle handelt, also Verwandte 2. Grades, hochbetagt, mit 80 oder 90 Jahren Erkrankte, dann ist der Fall sicherlich anders zu sehen. Aber auch hier stehen wir gerne zur Verfügung.
In Heidelberg wurde das Netzwerk Alternsforschung gegründet, hier arbeiten Wissenschaftler aus den Bereichen Biologie, Medizin, Gerontologie, Psychologie und Ökonomie zusammen. Was versprechen Sie sich in Bezug auf die Erforschung der Demenzen von dieser Zusammenarbeit?
Ich verspreche mir vor allen Dingen eine Intensivierung der Zusammenarbeit. Obwohl wir zum Teil schon langjährig kooperiert haben, ich denke da vor allem an die Arbeitsgruppe um Professor Beyreuther, aber auch die Arbeitsgruppen aus dem DKFZ, fehlte uns eine Plattform, von der aus wir unsere Anstrengungen systematisch zusammenfassen und vertiefen. Ich bin überzeugt, dass sich unsere Arbeit wechselseitig befruchten wird.
Was hat der Bürger davon?
Der Bürger kann eine bessere Versorgung aus dem Brückenschlag zwischen Grundlagen und klinischer Forschung erwarten.
Zur Person
Johannes Schröder, geboren 1957. Seit 1994 Leiter der Sektion Gerontopsychiatrie, nahm er 1999 den Ruf auf die Professur für „Klinische Psychiatrie“ an. Schwerpunkt seiner Arbeiten ist die Entstehung kognitiver Beeinträchtigungen und dementieller Erkrankungen aus Veränderungen des Gehirns. Dabei setzte er schon früh bildgebende Verfahren – so 1992 erstmals mit Kollegen aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum die funktionelle Magnetresonanztomographie – ein. Seine Arbeiten zur Behandlung und Erforschung psychischer Leiden im höheren Lebensalter - brachten ihm zahlreiche Preise ein - wie 2006 den "Alois Alzheimer-Preis" zusammen mit Tobias Hartmann/Universität des Saarlandes.
Der passionierte Segler aus dem oldenburgischen Lemwerder ist langjährig für den Umweltschutz engagiert.