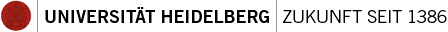Prof. Dr. Andreas Meyer-Lindenberg
Direktor des Zentralinstitutes für Seelische Gesundheit (ZI), Mannheim
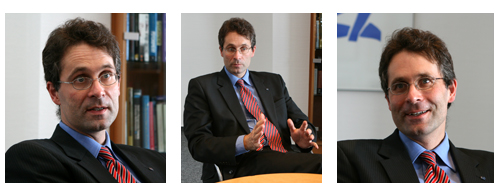
Interview vom 6. Oktober 2008 mit Dr. Birgit Teichmann
Die Erkenntnis, dass biologische Mechanismen für die Entwicklung psychiatrischer Symptome verantwortlich sind, begann sich Mitte der 70er Jahre durchzusetzen. Spätestens, seit in den 90er Jahren das „Human Genome Project“ mit dem Ziel startete, alle menschlichen Gene zu identifizieren, stellt sich die Frage, inwieweit menschliches Verhalten genetisch vorprogrammiert ist. 70% aller Gene werden im Gehirn exprimiert und beeinflussen damit Zellfunktion und somit Entwicklung und Funktion komplexer Hirnsysteme.
Ist der Mensch, zumindest in Bezug auf sein Verhalten, doch „Sklave“ seiner Gene?
Sicherlich nicht! Der genetische Anteil, also die Erblichkeit, bewegt sich zwischen 20, 40, vielleicht 50%, d.h. aber nicht, dass irgendein einzelnes Gen oder auch eine Kombination bekannt wäre, die das Verhalten im Wesentlichen bedingt. Nichts desto trotz ist es natürlich interessant zu schauen, wie die Gene an der Steuerung von Verhalten teilnehmen, nicht weil die Gene die entscheidenden Kriterien dafür sind, sondern weil wir auf diese Weise herausfinden können, was aus biologischer Sicht diesem Verhalten zu Grunde liegt.
Und welchen Einfluss hat die Umwelt?
Wir schätzen, dass der Einfluß der Umwelt bei den meisten sozialen Verhaltensweisen ebenso groß ist, wie der Anteil der Gene selber und, dass Gene und Umwelt ja nicht für sich stehen, sondern miteinander interagieren. Es gibt bestimmte Gene, die das Risiko erhöhen, auf einen bestimmten Umweltstress mit Depressionen oder einer Angstreaktion zu reagieren. Diese Gen- Umweltinteraktionen sind wahrscheinlich die, die den Löwenanteil an einem sehr komplexen Ursachengeflecht, dass jede solche Verhaltensweisen hat, ausmachen.
Können wir auch Träger der „aggressiv machenden“ Versionen bestimmter Gene haben und dennoch ein unauffälliges Leben führen?
Ja, auf jeden Fall. Also diese aggressiv machenden Gene, mit denen wir uns sehr beschäftigt haben, haben für sich alleine sicherlich nur einen ganz minimalen Anteil am aggressiven Verhalten und insofern macht es auch keinen Sinn, im Einzelfall, dieses Gen zu messen. Wir sind das oft im Zusammenhang mit Leuten, bei denen die Todesstrafe erwogen wird, gefragt worden. Da diese Gene eben doch das kleine Bisschen zur Neigung, aggressiv zu reagieren, beitragen, können wir das Gen untersuchen, um etwas über Aggressionen zu lernen, wenn auch nicht im Einzelfall.
Sie haben festgestellt, dass die Gene nicht nur den Stoffwechsel im Gehirn sowie die Erregbarkeit der Neuronen beeinflussen. Ihr Einfluss verändert auch die Struktur jener Gehirnzellen, die mit der Kontrolle des menschlichen Sozialverhaltens und seines Gefühlslebens beschäftigt ist. Wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt im Gehirn Regelkreise, die solche Dinge wie basale Emotionen oder das Aufmerksamkeitsniveau regulieren. Diese sind im Wesentlichen unserer Aufmerksamkeit entzogen, aber haben einen großen Anteil daran, wie wir uns fühlen und wie wir auf Umweltreize reagieren. Wir haben gefunden, dass Gene einen großen Einfluss daran haben, wie diese Regelkreise, gerade im Zusammenhang mit basaler Emotionsverarbeitung, verschaltet sind und zwar in der Weise, dass üblicherweise Gene, die das Risiko erhöhen, depressiv zu werden, aggressiv zu werden, Angstreaktionen zu zeigen, die Funktionen des Regelkreises stören. Er ist weniger stark verdrahtet und das hat je nachdem vielleicht für sich gar keinen Einfluß, aber wenn dann noch ein Umweltstressor dazu kommt, dann kann es sein, dass das System durchkompensiert und man reagiert in einer krankheitswertigen Weise.
Was versteht man unter „Imaging Genetics“?
Das ist ein Arbeitsansatz, mit dem man versucht, Gene in Zusammenhang mit der Gehirnfunktion zu bringen. Man nimmt eine große Gruppe von Leuten und bestimmt ihre genetischen Varianten, dann misst man die Gehirnfunktion mit Hilfe beispielsweise der funktionellen Kernspintomographie, wie wir sie hier am ZI oder auch an der Universität Heidelberg machen können oder auch die Hirnstruktur. Wir können die Größe des Gehirns, die Größe der verschiedenen Gehirnstrukturen messen. Dann schauen wir uns den Zusammenhang zwischen der genetischen Variante und der Größe einer Hirnregion, die uns interessiert, an oder der Aktivität oder der Art und Weise wie diese Hirnregionen miteinander verschaltet sind.
Welchen Einfluss haben diese neuen Methoden auf Diagnose und Therapie?
Der Einfluss ist noch relativ begrenzt, das wird sich in den nächsten Jahren aber sicherlich ändern, denn wir finden durch diesen „Imaging Genetic“-Ansatz Hirnsysteme, die mit genetischem Risiko etwas zu tun haben und wir haben bereits erste Anzeichen dafür, dass das auch präventiven Wert haben kann, beispielsweise um zu wissen, wer auf ein bestimmtes Antidepressivum anspricht oder nicht, oder wer von einer bestimmten Therapieform profitieren könnte oder nicht. Die Gene selber erklären nicht wirklich, welchen hohen Anteil jedes einzelne Gen an diesen Verhaltensweisen hat. Aber Die Gehirnmechanismen, die wir durch die Gene gefunden haben, erklären im Einzelfall schon so viel an der Variabilität in diesem uns interessierenden Phänomen, dass wir sie tatsächlich auch präventiv einsetzen können, also beispielsweise um zu schauen, wer wird sich auf ein bestimmtes Antidepressivum bessern.
Jetzt hat man ja festgestellt, dass einige Gene dazu führen, dass sich bestimmte Gehirnstrukturen anders entwickeln. Könnte man sich auch vorstellen, dass man schon bei Kindern das entsprechende Gen ersetzt, damit sich das Gehirn normal entwickeln kann – oder ist das eine Zukunftsvision?
Also vorstellen kann man sich vieles. Tatsächliche Anwendung von so einer Gentherapie, in der man tatsächlich in das Erbgut des Menschen eingreift, ist noch in weiter Ferne. Wir interessieren uns aber sehr dafür, wie sich diese genetische Variation in der Entwicklung, also gerade im Kindesalter, abbildet und wenn man auch nicht das Gen selber ersetzen kann, so kann man doch durch ein Verständnis der Mechanismen, sich überlegen, wie man die Hirnareale, die noch gut funktionieren, trainieren kann, um ihre Funktion gewissermaßen zu stärken. Das Gehirn ist ja Gott sei Dank plastisch und kann sich von sämtlichen früh einsetzenden Störungen wieder ein Stück weit erholen, besonders wenn wir ihm die entsprechende Therapie und Übungsverfahren zur Verfügung stellen.
Brauchen wir nicht – trotz allem – das „Abnormale“, das „Anders-Sein“, um unsere Welt interessanter zu gestalten. Ohne ihre Andersartigkeit hätten viele Künstler vielleicht nicht das geschaffen, was sie mit ihrer Krankheit erreicht haben. Ein gutes Beispiel hierfür ist vielleicht die Prinzhorn-Sammlung.
Es ist sicher so, dass wir Variationen im menschlichen Leben brauchen und ich will die Dinge, die ich untersuche auch nicht pathologisieren. Also nur, weil eine bestimmte genetische Variante damit in Verbindung gebracht worden ist, ist es deshalb nicht abnorm oder krankheitswertig. Keinesfalls! Viele der Dinge, die wir untersuchen, beispielsweise mehr oder weniger ängstlich zu sein, mehr oder weniger aggressiv zu sein, gehören zum Normalrepertoire. Unser aller Verhalten und dass das wir im bestimmten Kontext krankheitswertig nennen oder nicht so nennen, steht in demselben Beziehungsgeflecht. Also ich denke dadurch, dass wir unser Verständnis erweitern, sollten wir eher das Stigma abbauen, das bestimmten seelischen Störungen nach wie vor anhängt und ich würde es sehr bedauern, wenn das Umgekehrte eintreten würde und wir Bereiche des normal psychologischen pathologisieren, das soll also nicht der Fall sein
Zur Person
Andreas Meyer-Lindenberg wurde 1965 in Bad Godesberg geboren. Er studierte Medizin in Bonn. Seine wissenschaftliche Ausbildung absolvierte er in Bonn, New York und National Institute of Mental Health, Bethesda. Seit Juli 2007 ist Andreas Meyer-Lindenberg Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI), Mannheim.
Der wissenschaftliche Schwerpunkt seiner Arbeit ist die Erforschung der Schizophrenie und Depression mittels bildgebender, genetischer und psychopharmakologischer Methoden sowie die Untersuchung biologischer Mechanismen des menschlichen Sozialverhaltens.
Andreas Meyer-Lindenberg ist verheiratet und hat zwei Kinder. In seiner Freizeit findet man den Opernfan in den Opernhäusern von Mannheim und Stuttgart.