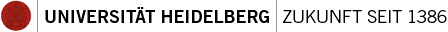Andreas Wenderoth
 Andreas Wenderoth
Andreas Wenderoth
Autor und Journalist, Berlin
Interview vom 11. Mai 2017 zum NAR-Seminar
„Demenz – literarisch und ethisch betrachtet“
(durchgeführt von Andrea Germann)
Die Medizin vergisst oft, die Sicht des Patienten und der Angehörigen miteinzubeziehen. Berichte geben uns eine Einsicht in ihre subjektive Story, ihr Krankheitsbild, Erfahrungen mit Krankheiten. Diese Berichte machen eine Krankheit fühlbar, erfahrbar. Ihr Buch ist eine Collage aus dem subjektiv Erlebten und eine Reportage, in der sie diverse wissenschaftliche Quellen nennen.
In der Tat habe ich mich, weil ich von Zeit zu Zeit die rein persönliche Situation durchbrechen wollte, mit einer ganzen Reihe von Wissenschaftlern getroffen. An einer Stelle des Buches hätte das ja fast zu einer Art Happy End geführt. Ein Forscher der Charité hatte mir auf den Kopf zugesagt, dass mein Vater möglicherweise an einer ganz anderen Form der Demenz leidet. Es gibt nämlich eine bisher unbekannte Form, die als Auto-Immunkrankheit wirkt. Das Interessante daran: Man kann etwas dagegen tun. In einer weltweiten Studie wurden 12 Patienten mit gutem Erfolg behandelt.
Das ist die Geschichte mit der Blutprobe. Das hat leider nicht so geklappt, wie Sie es sich erhofft haben: „Eine Woche später liegt das Ergebnis vor: negativ. Die gesuchten Antikörper wurden nicht festgestellt. Damit ist einerseits die Hoffnung zerstört, dass er einer der vergleichsweise wenigen Demenzpatienten ist, denen man helfen kann. Allerdings muss man auch nicht bedauern, dass man nicht rechtzeitig therapiert hat – eineinhalb Jahre nach dem kräftigen Ausbruch wären natürlich so oder so schon sehr viele Gehirnzellenzerstört worden. Wir können uns nicht vorwerfen, etwas versäumt zu haben.“ War es für sie traurig, dass es bei Ihrem Vater leider nicht funktioniert hat? Wie war es für Sie, da Sie ein bisschen Hoffnung bekommen haben?
Natürlich war ich traurig, dass wir nicht aktiv werden konnten. Gut, man hätte das Rad nicht zurückdrehen können, der Gehirnschwund wäre ja da gewesen, aber man hätte ihn möglicherweise aufhalten können. Was man normalerweise ja nicht kann. Demenz gilt bis heute als nicht behandelbar. Nach meinem Wissensstand gibt es bei Alzheimer vier zugelassene Mittel, mit denen man den Verlauf leicht verzögern kann, heilen kann man die Krankheit nicht. Bei der vaskulären Demenz kann man den Verlauf noch nicht einmal verzögern. Also traurig ja, aber wenn das Ergebnis anders gewesen wäre, wäre trotzdem nicht klar gewesen, ob ich meinen Vater zum Mitmachen hätte überreden können. Da wäre eine ziemlich massive Behandlung auf ihn zugekommen: eine Mischung aus Blutwäsche und leichter Chemotherapie. Insofern war seine Reaktion einerseits merkwürdig, vor dem Hintergrund der Krankheit, dann aber wieder verständlich: Er hat sich gefreut, dass bei dem Blutbild nichts herausgekommen war, weil es ihm aus seiner Sicht weitere Schwierigkeiten bereitet hätte.
Simonides hat mal gesagt, dass die Malerei stumme Dichtung ist und Dichtung sprechende Malerei. Sie zeichnen in ihrem Buch sehr viele Metaphern - Bilder der Krankheit. Dient es einer Veranschaulichung für den Leser oder ganz für sie alleine, um zwischen der Krankheit und dem Menschen zu differenzieren?
Ich versuche grundsätzlich eher bildhaft zu schreiben; eine gute Metapher ist viel wert, eine schlechte natürlich gar nichts. Metaphern sind ein Teil der Sprache, ein Mittel, sie lebendig zu gestalten. Insofern ist es für mich nichts Besonderes, sie zu verwenden.
Sie haben eine sehr besondere Art zu beschreiben. Durch knappe Sätze wie diese: Die Krankheit offenbarte sich „an einem schneelosen Sonnabend im November 2013“. „Meine Mutter am Telefon ist ganz aufgelöst: Der Vater sei aggressiv gegen sie. Er rede wunderlich und wolle die Tabletten nicht von ihr nehmen.“ Da bekommt man fast eine Gänsehaut und fühlt die Kälte und auch das, was auf die Familie zukommt. Sehr beindruckende und stimmungsvolle Worte. Oder an einer anderen Stelle: „Mein Konto war überzogen und Geduld mit Alexandra auch.“ Müssen Sie lange darüber nachdenken, was und wie Sie schreiben, denn Sie geben dem Leser komplexe Impressionen, die mit der Krankheitsgeschichte begleitend kommen. Ist das ad hoc oder müssen Sie viel nachdenken und korrigieren?
Ich wollte natürlich nicht einfach einen weiteren Demenzratgeber auf den Markt bringen, da gibt es bereits sehr viele. Mein Anspruch war es schon, literarisch darüber zu schreiben, was die Demenz mit einer Familie macht. Ich bin nicht unbedingt ein konzeptioneller Schreiber, muss also in aller Regel erst anfangen zu schreiben, um zu sehen, wo es mich hinführt. Es gibt Kollegen, die machen das drehbuchartig, schreiben alles auf und wissen schon vorher, was am Ende herauskommt. Ich weiß das eher selten, lasse mich insofern auch von mir selbst gern überraschen. Ich streiche natürlich auch viel beim Schreiben und ich hoffe, dass in der Regel nur das Gute übrig bleibt.
Sie beschrieben dann an mehreren Stellen, wie kreativ Ihr Vater geworden ist. Ist das etwas Besonderes, was die Erkrankung mit sich bringt?
Das ist, denke ich, ein völlig unterbelichteter Teil der Demenz, weil sie normalerweise nur pathologisch betrachtet wird – als Krankheit. Dass Demenz auch eine kreative Seite hat, fand ich sehr spannend und im Falle meines Vaters eben auch beschreibenswert. Mein Vater war immer ein Mann der Sprache und jetzt – im langsamen, allmählichen Verschwinden seiner Persönlichkeit – versucht er die Tatsache, dass er nicht mehr so viel zu sagen hat, zu kaschieren mit sehr wortreichen Umschreibungen, die zum Teil über eine regelrechte poetische Strahlkraft verfügen. Allein wenn ich an den Titel des Buches denke, den habe ich mir ja nicht überlegt, es ist sozusagen ein Geschenk meines Vaters, der eines Tages sagte: „Entschuldige mich bitte für meine Inhaltslosigkeit, aber ich bin nur noch ein halber Held“ – was für ein Satz! Da bekomme ich Gänsehaut, bis heute.
Da ist einerseits die kreative sprachliche Verwendung, anderseits natürlich auch immer der Verlust an Fähigkeiten. So hat er zum Beispiel den Zugang zur Musik verloren. Das trifft sie ganz besonders, habe ich das richtig herausgelesen?
Absolut. Neben der Literatur war die Musik immer das Verbindungsglied zwischen uns. Mein Vater hat mich im Grunde zur Musik geführt. Ich habe den Jazz durch ihn kennengelernt und die Klassik, wenn auch mit dem Jazz-Argument. Er hat gesagt: „Bach swingt“, tja und das musste ich natürlich sofort überprüfen. Seitdem bin ich ein großer Bach-Fan. Wir haben uns immer viel über Musik ausgetauscht und sind auch zusammen in Konzerte gegangen. Dass diese Schnittmenge irgendwann nicht mehr da war, habe ich sehr vermisst.
Haben Sie ihren Vater trainiert? Sie haben beschrieben, dass er das Gehen fast verlernt hat, sie haben ihm geholfen, dass er Sie doch besucht im vierten Stock. Bei dem Besuch haben Sie ihm ihr Musikzimmer vorgeführt. War das für sie ein Ansporn, ihm ihre neue Wohnung zu zeigen, besonders ihr Musikzimmer, um ihm zu zeigen, da ist eine Verbindung zwischen Ihnen beiden.
Ich wollte ihm nichts beweisen. Es war sein großer Wunsch, meine neue Wohnung kennenzulernen. Über Monate hat er immer wieder erzählt, warum ihm das nicht möglich war. Aber irgendwann hatten wir eine Lösung gefunden. Natürlich wollte ich es ihm möglichst leicht machen. Wir haben also gesagt, wir stellen einfach in jede Etage einen Stuhl. Wenn er will, bekommt er beim Aufstieg in jedem Stockwerk etwas zu trinken oder zu essen, und dann sind wir in ein geradezu komödiantisches Spiel verfallen, weil wir uns ausgemalt haben, was bei diesem Besuch alles passieren könnte. Er hat ja immer noch sehr lange gemerkt, dass er mir damit eine Freude machte. Und, was absolut ungewöhnlich bei dieser Krankheit ist: Er hat sich auf wunderbare Weise sehr lange seine Selbstironie erhalten.
Das war sehr spannend zu lesen, wie Sie praktisch auf diesen Punkt des Besuches hineingearbeitet haben und auch sehr motivierend, glaube ich, für andere zu sehen – wenn wir uns kleine und kurzfristige Ziele uns setzen – können wir diese auch erreichen und auch Menschen mit Demenz motivieren.
Wobei wir immer schauen müssen, in welcher Phase sich der Demenzerkrankte gerade befindet. Jetzt wäre das nicht mehr möglich. Zum Glück habe ich über eine Phase geschrieben, in der wir – auch wenn das in diesem Zusammenhang vielleicht missverständlich klingen mag – immer noch sehr viel Spaß und auch Freude zusammen hatten.
Sie haben sich entschieden, ihrem Vater immer die Wahrheit (über die Krankheit und ihre Auswirkung auf Sie oder Ihre Mutter) zu sagen. Bereuen Sie das? Oder hat dies ihre Beziehung zueinander eher verstärkt, da sie ihm dadurch die Selbstbestimmung und Würde nicht genommen haben?
Nein, es ist ja so, dass er selbst auf einer bestimmten Ebene gemerkt hat, dass er nicht funktioniert hat, er hatte nur nicht das Wort dafür. Anders als bei Alzheimer ist sich jemand, der unter der sogenannten vaskulären Demenz leidet, oft sehr lange seines Zustandes bewusst, der Verstand leistet mehr als sein Gedächtnis. Der Betroffene weiß also oft, was er eigentlich hätte wissen müssen. Und das ist das Problem meines Vaters. Deshalb war ich mir oft nicht sicher, ob ich ihm nun mehr Klarheit oder stärkere Nebel wünschen sollte. Die Frage stellt sich inzwischen nicht mehr, die Nebel haben obsiegt.
Er wusste also, dass er dement ist?
Er konnte es nur nicht so nennen. Und hat auch sehr unterschiedlich darauf reagiert, wenn wir darüber gesprochen haben. Manchmal war er erleichtert, aber dann gab es immer wieder auch jene Tage, an denen er sich völlig schockiert über diese Information zeigte, obwohl wir natürlich schon 50 Mal darüber gesprochen hatten. Er sagte dann oft: „Dass du mir das jetzt in dieser Heftigkeit sagen musst.“ Aber auch das hat er natürlich ein paar Minuten später wieder vergessen.
Jede schwere Krankheit verändert eine ganze Familie, die Selbstverständlichkeiten können nicht mehr so wahrgenommen werden wie bisher, Rollen werden neu belegt. Wie ist oder war es für Sie, als Sie von der Rolle des Sohnes - Sie sind, glaube ich, das einzige Kind - Richtung pflegender Angehöriger, gar „Entscheider“ gewechselt haben, oder derjenige waren (wurden), der sich doch um das Wohl der eigenen Mutter sorgen muss, damit sie weiterhin intakt bleibt und nicht an der Pflege des Ehemannes zusammenbricht.
Na ja, das ist eine Aufgabe, von der ich gar nicht weiß, ob sie schon bewältigt ist. Für mich war sie natürlich ungewohnt, aber ich will meinen Part hier nicht überbewerten. Diejenige, die täglich seinen Befindlichkeiten ausgesetzt war, ist meine Mutter. Die Hauptverantwortung lag und liegt nach wie vor bei meiner Mutter. Wir sind nicht immer einig darin, wie man sich mit der Krankheit verhält, oder auch wie man aufpassen muss, dass man seine Seelennahrung nicht verliert. Wie viele pflegende Angehörige ist meine Mutter inzwischen in die Depression geglitten.
Ihre Mutter hat einmal im Buch exzellent reagiert, als dieser Wunsch, gemeinsam zu sterben, erneut geäußert wurde. Da antwortete sie erst: „… ne, lass uns erstmal Tee trinken…“ Nun, wenn so eine Einladung 17 Mal am Tag kommt, hat man nicht immer solche hervorragenden Antworten parat.
Ja, fand ich auch großartig, sie hatte da ein ganz anderes Konzept. Ich dachte, ich müsse alles lesen, um mich zu informieren. Meine Mutter wollte das überhaupt nicht, wollte sich nicht auch noch mit den Krankheiten Anderer beschäftigen, weil diese eine Krankheit für sie Last genug war. Sie hat sich eigentlich nie theoretisch damit auseinandergesetzt. Praktisch hat sie sich aber fast immer hervorragend und intuitiv richtig verwalten – was eine große Leistung ist.
Ihr Vater hat eine Frage gestellt, rhetorisch, oder wie auch immer: „Ist es legitim, zu verblöden?“. Haben Sie selbst eine Antwort auf diese Frage gefunden?
Das ist keine Frage, auf die er eine Antwort erwartet hat, er hat immer, auch zu seinen guten Zeiten, das Leben in Frage gestellt, war ein eher pessimistischer Geist. Das Alter war für ihn immer schon eine Zumutung und durch die Demenz hat dies noch seine Zuspitzung erfahren.
Haben Sie selbst Angst, an Demenz zu erkranken
Natürlich. Mein Vater hatte früher immer auch hypochondrische Züge, und ich denke, ich habe da einen Teil abbekommen. Mein neues Buch handelt übrigens genau davon. Ich gebe zu, dass diese doch sehr realen Krankheitserfahrungen meine Lust aufs Alter nicht eben stärken.
Haben Sie sich das, was Sie in dem Buch schreiben, überlegt bzw. mit anderen Familienmitglieder abgestimmt, denn es ist schon ein Schritt, mit so einer privaten Sache öffentlich zu werden.
Ich habe zu einer Zeit begonnen zu schreiben, als ich mit meinem Vater noch gut diskutieren konnte. Er hat natürlich nicht alles verstanden, aber die Grundrichtung schon, und ich habe von allen in der Familie Zustimmung für das Buch-Projekt bekommen. Weil wir der Meinung waren, dass die positiven Seiten deutlich die möglichen negativen überwiegen. Mein Vater hat dieses Noch-mehr-an-Zuwendung sehr genossen. Ich habe mich mit dem Aufnahmegerät zusammen mit ihm hingesetzt und ich weiß nicht, wie viele, vermutlich an die 50 Stunden, aufgenommen.
Das ist sehr interessant, was Sie da beschreiben. David Sieveking hat seine Mutter auch mit der Kamera begleitet und er hat das Gleiche gesagt, seine Mutter genoss die Aufmerksamkeit, die sie durch die Kamerapräsenz bekommen hat.
Das Aufnahmegerät war nichts Besonderes für ihn, er was ja selbst Rundfunkredakteur gewesen. Und erst recht nicht war es für ihn etwas Unangenehmes, über seine Befindlichkeiten zu reden. Das hat er schon in seinen besseren Zeiten stets gerne und ausgiebig gemacht. Ein Rundfunkkollege hat mal über ihn gesagt: „Ihr Vater war ein wunderbarer Mensch, nur durfte man ihn nie fragen, wie es ihm geht.“ Meiner Mutter hat das Buch ihre Situation insofern erleichtert, weil sie nun nicht mehr umständlich erklären musste, was sie täglich für Befindlichkeiten ausgleichen muss, sie konnte nun einfach das Buch verteilen. Ich hatte natürlich auch ein egoistisches Motiv: Ich weiß nicht, ob ich mit diesem Abschied auf Raten, der es ja nun einmal ist, sonst klar gekommen wäre. Mir persönlich hat es sehr geholfen. Sozusagen auch ein kleiner selbsttherapeutischer Ansatz.
Das beantwortet fast meine letzte Frage: Für wen haben Sie geschrieben? Das haben Sie nun beantwortet.
Nein, ich habe ja nur für unsere Familie gesprochen. Und natürlich ist es in erster Linie eine Liebeserklärung an meinen Vater. Im Grunde aber will ich Demenzerkrankten mit dem Buch eine Stimme geben. Deshalb sind auch immer wieder Dialoge eingestreut. Das Buch soll auch ein Plädoyer dafür sein, die gemeinsamen Momente zu nutzen und die Zuwendung nie einzustellen. Wenn mein Vater es jetzt auch nicht mehr verbal artikulieren kann: Auf der Gefühlsebene bekommt er immer noch sehr viel mit.